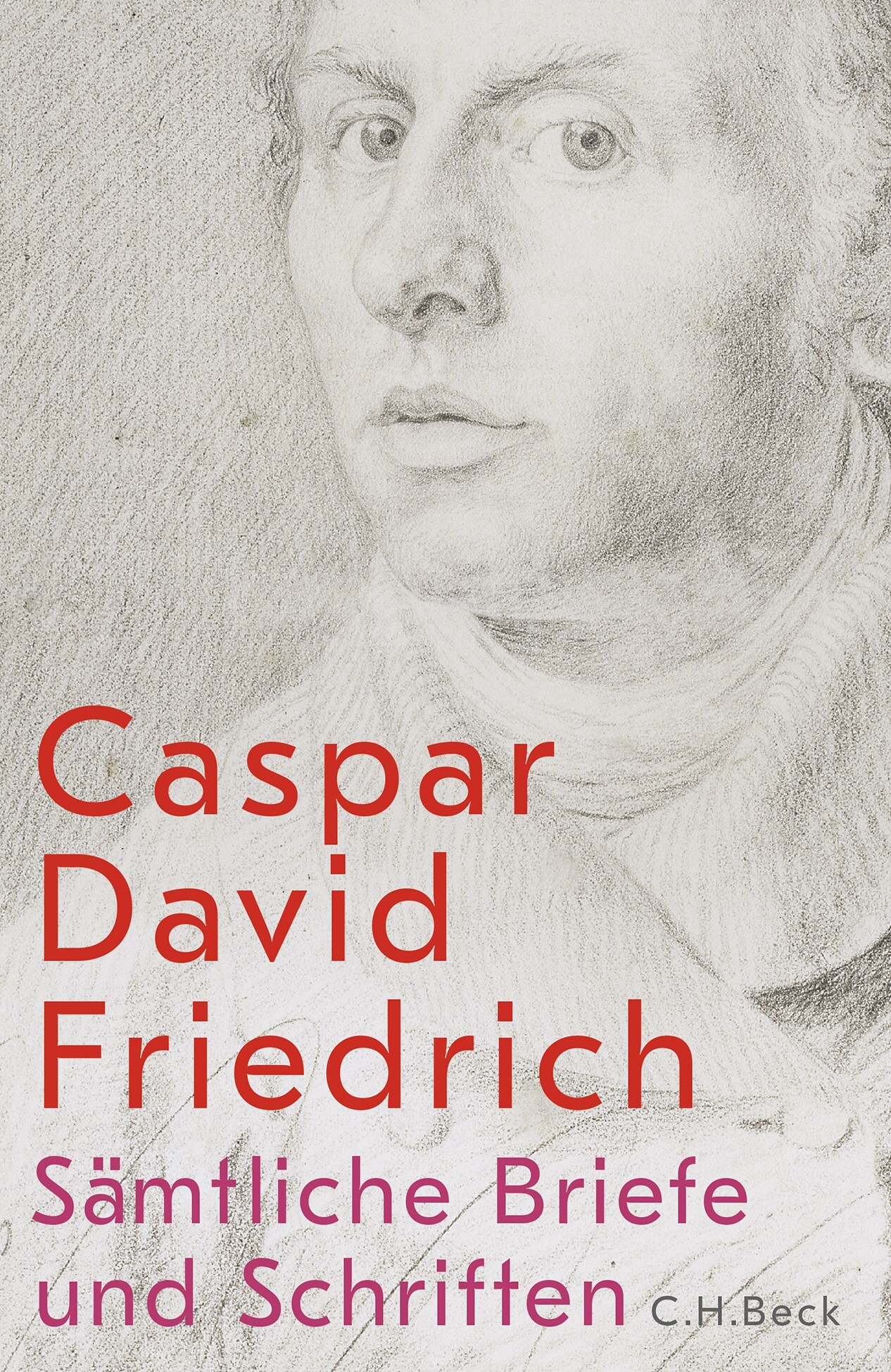Johannes Grave, Petra Kuhlmann-Hodick und Johannes Rößler (Hgg.)
Caspar David Friedrich
Sämtliche Briefe und Schriften
Dass Caspar David Friedrich in der Malerei der Romantik eine herausragende Position zukommt, ist unumstritten. Diese Einschätzung, die sich in der Rezeptionsgeschichte seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts verfestigt hat, wurde z. B. im Titel einer 2006/2007 vom Museum Folkwang Essen und der Hamburger Kunsthalle veranstalteten Friedrich-Ausstellung auf die Formel „Erfindung der Romantik“ gebracht. Das lässt sich so verstehen, als habe Friedrich als einziger Maler seiner Zeit das Konzept der im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts entstandenen philosophischen, religiösen und literarischen Bewegung namens Romantik wirklich verstanden und eine Malerei geschaffen, die diesem Konzept einen gültigen Ausdruck verliehen habe. Aus heutiger Perspektive könnte man auch sagen: Man versteht die Romantik als Ganzes nur dann, wenn man auch die Bilder Friedrichs verstanden hat. Die Frage ist allerdings, wie sich dieser Zusammenhang von Literatur, Philosophie, Religion und Malerei biographisch und werkgeschichtlich fassen lässt.
Es ist naheliegend, dass die Friedrich-Forschung bei der Beantwortung dieser Frage dessen Schriften herangezogen hat. Es ist deswegen sehr zu begrüßen, dass in der vorliegenden Neuedition „erstmals alle bekannten und überlieferten Texte des Künstlers in einem Band“ (S. 309) präsentiert werden, und dies in einer Qualität, die im Hinblick auf Textgestalt und Kommentar allen Anforderungen in vorbildlicher Weise entspricht (zur Konstitution der Textgestalt S. 317 f., zum Kommentar S. 320). Das Ergebnis ist ein Beispiel für nachhaltige Grundlagenforschung, auf deren Basis die zum größten Teil bekannten und oft zitierten Textpassagen in ihrem diskursgeschichtlichen Kontext neu erschlossen werden können. Damit eröffnet die Edition neue Perspektiven über die Kunstwissenschaft hinaus, auch für die literaturwissenschaftliche Romantikforschung, aus deren Sicht diese Rezension geschrieben ist.
Das Herausgeberteam konnte auf eine längere Editionsgeschichte zurückgreifen, die mit der Publikation von Teilen der Äußerungen bei Betrachtung einer Sammlung von Gemählden durch Carl Gustav Carus im Jahr 1840 begonnen hat. Der aktuelle Stand der Editionsgeschichte ist mit der vollständigen Edition der Äußerungen von Gerhard Eimer (1999) und der ersten textgetreuen und kommentierten Ausgabe der Briefe von Hermann Zschoche (2005/2006) erreicht worden, auf die das Herausgeberteam zurückgreifen konnte. Von diesen Editionen unterscheidet sich die neue Ausgabe dadurch, dass sämtliche Schriften in einem einzigen Band zusammengeführt worden sind, und dass einige Texte aufgenommen worden sind, die von den bisherigen Herausgebern wohl für unerheblich gehalten worden sind. Die Gedichte Tanzet und singet sowie Dann wollen wir die Gläser leeren (S. 205 f.) z.B. passten wohl nicht zum Image des einsamen Melancholikers, das zu revidieren ja eine unbefangene Lektüre der Briefe ohnehin veranlassen sollte. Die Textgestalt ist das Ergebnis eines kritischen Vergleichs der Originale mit den bisherigen Editionen, einschließlich der Analyse von Papierqualität und Tinten. Das führte vor allem bei dem Textkonvolut der Äußerungen zur Klärung von Datierungsfragen und zu vielen Verbesserungen der Textwiedergabe, auch gegenüber den Editionen von Eimer und Zschoche. Neben scheinbaren Kleinigkeiten – z.B. „Liena“ statt „Liene“ (vgl. S. 484) für den Vornamen der Ehefrau, „Vinerische“ statt „venerische“ Krankheit (S. 542) – ist mir eine Textverbesserung von erheblicher Bedeutung ins Auge gefallen. Sie betrifft eine Stelle aus dem Brief an Luise Seidler (Nr. 30, S. 67), wo sich der Maler zum „Kreuz an der Ostsee“ äußert: „An nackten steinigen Meeresstrande steht hoch aufgerichtet das Kreutz, denen so es suchn ein Trost, denen so es nicht suchn ein Kreutz.“ Bis zur Textrevision (vgl. S. 412 f.) las man „sehen“ statt „suchn“. Welche Folgerungen sich daraus ergeben, lässt sich erst bei einem Blick auf die Herausforderungen erkennen, denen man angesichts der Kontexte konfrontiert ist.
Der Kommentar liefert für die Kontextualisierung von Friedrichs Werk eine gute Ausgangsbasis. Als Leistung von Johannes Grave und Johannes Rößler, die den Kommentar verantworten, ist hervorzuheben, dass sie bei den Erläuterungen immer auf die Deutungsvorschläge der bisherigen Forschung verweisen und so einen zuverlässigen Überblick über die Rezeptions- und Forschungsgeschichte ermöglichen. Vermieden werden aber einseitige Präferenzen bei der Bewertung unterschiedlicher Thesen. Der Textsorte ‚Kommentar‘ entsprechend verzichten sie weitgehend auf bevormundende Deutungen und lassen Spielraum für eigene Urteile. Die Distanz zu Deutungsvorschlägen der bisherigen Forschung wird gelegentlich nur mit „spekulativ“ (S. 578) markiert. Damit ist ein weiter Rahmen für die Diskussion der Kontextualisierung von Friedrichs Werk abgesteckt.
Johannes Grave betont in der Einleitung, dass die Meinung, „Schreiben [sei] nicht Friedrichs Sache gewesen“ (S.7), und „seine […] Individualität [trete] umso entschiedener in seinen Bildern“ hervor (ebd.), angesichts zahlreicher Spuren der Lektüre zeitgenössischer Literatur revidiert werden müsse. Friedrich gehöre zu jener Künstlergeneration, „die zunehmend auch in Texten über das eigene künstlerische Tun reflektierte“ (S. 17). Schon damit erweist sich Friedrich als Romantiker, weil das Postulat der Selbstreflexion ein grundlegendes Element romantischer Ästhetik ist. Es bleibt m. E. aber doch der Eindruck bestehen, dass der Maler sich mit längeren philosophischen oder theologischen Texten nicht eingehend befasst hat. Dass Friedrich zudem die Arbeit an der Staffelei für wichtiger gehalten hat als die Arbeit am Schreibtisch, das dokumentieren wiederholte Äußerungen, wie z.B.: „Ich werde meinen Brief kurz zu fassen für heute bemüht sein; weil ich gern wieder an die Staffelei möchte.“ (Nr. 70, S. 132) Die lakonische und oft kryptische Ausdrucksweise setzt überdies dem Nachweis einer Rezeption bestimmter Texte Grenzen, auch wenn der Kommentar hierzu an vielen Stellen hilfreiche Vorschläge macht.
Friedrichs Umgang mit längeren Texten ist in einem Brief an Friedrich August Koethe dokumentiert, der ihm drei seiner Vorlesungen zugeschickt hat: „Den ganzen Werth Ihres Geschenks vermag ich nicht zu erkennen, was ich aber erkannt oder verstanden habe, h ist mir lieb und werth. Sie wissen lieber Köthe daß ich keiner von den hochgelahrten Künstlern unsrer Zeit bin, mit hin wird es Ihnen nicht befremden wenn ich Ihre Vorlesungen nur zum Theil verstanden habe. Ich bin keiner von den sprechenden Mahlern deren es jetzt so viele giebt, so im stande sind vierunzwanzig mal in einem Athen zu sagen was Kunst ist werent sie nicht imstande gewesen in 24 Jahren ein einzig mal in ihren Bildwerken zu zeigen was Kunst ist. Und so ist es denn geschehen daß eine menge dieser Herr<en> einsgeworden mit Worten auszusprechen was sie mit Farben und Formen nicht vermögen.“ (Nr. 19, S. 54) Entsprechend dieser Äußerung wird man auch nicht annehmen wollen, dass Friedrich grundlegende Texte der Frühromantiker eingehend studiert und den Ehrgeiz gehabt hat, eine Theorie romantischer Malerei zu formulieren. Alles, was er zu sagen hatte, sagte er anlassbezogen in Andeutungen über seine eigenen Werke und in kritischen Bemerkungen über die Bilder anderer Künstler. Das Wichtigste sollte nach eigenem Bekunden durch „Farben und Formen“ geleistet werden. Die Bezüge zu bestimmten Texten der Romantiker, auf die im Kommentar hingewiesen wird, etwa zu Novalis (vgl. S. 651, S. 673), zu Schleiermacher (vgl. S. 376, S. 354), zu Schelling (vgl. S. 632 f.) sind alle zu unspezifisch, um deren Lektüre wahrscheinlich zu machen. Wenig hilfreich sind auch Verweise auf Textstellen aus entfernteren Bereichen, etwa zu Angelus Silesius oder zu Martin Luther, die im Kommentar von den Herausgebern – mit Distanz – referiert werden (vgl. S. 577 f.). Wenn im Kommentar auf eine Verszeile aus Goethes Schäferspiel Die Laune des Verliebten hingewiesen wird (S. 579), verrät dies freilich, dass auch die Herausgeber gegen diese Praxis nicht ganz gefeit sind.
Gegen dieses Verfahren ist nach dem Vorschlag von Johannes Grave ein anderer Weg in Betracht zu ziehen: In Dresden bewegte sich Friedrich „spätestens ab 1806 […] in einem ebenso anregenden wie anspruchsvollen intellektuellen Umfeld, das ihn mit aktuellen Diskussionen über Literatur, Künste, Wissenschaften und Politik vertraut gemacht haben muss.“ (S. 14f.) Er informierte sich auch in den gängigen Journalen, und wenn man an die vielen prominenten Besucher in seinem Atelier denkt und sich vorstellt, welche Gespräche dort vor seinen Bildern geführt worden sein dürften, so darf man annehmen, dass grundlegende Gedanken der Romantik ihm auf diesem sozusagen ‚diskursiven‘ Weg vermittelt worden sind. Es erscheint mir deswegen angemessen, in den schriftlichen Äußerungen Friedrichs die Spuren jener Muster freizulegen, die sich nach 1800 in der Phase der Vereinfachung der frühromantischen Gedankenexperimente gebildet und verbreitet haben, eines ‚romantischen Diskurses‘, wie man sagen könnte, ohne sich auf den Nachweis des Einflusses durch einzelne Texte zu kaprizieren. An einem ‚Diskurs‘ ist man beteiligt, ohne die Äußerungen im Einzelnen kennen zu müssen. Zur Verdeutlichung dieser Muster wird man zwar rezeptionsleitende Texte der Frühromantiker (Novalis, August Wilhelm und Friedrich Schlegel, Schleiermacher) heranziehen dürfen, aber auch Texte aus jener Phase der Romantik berücksichtigen müssen, in der sich im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts die Versuche der Frühromantiker zu einem ‚Schulzusammenhang‘ verfestigt haben. Zu denken ist dabei an die Teilveröffentlichung der Berliner Vorlesungen von August Wilhelm Schlegel (1801–1804) in der Zeitschrift „Europa“ (1803), an Gotthilf Heinrich Schuberts Ansichten von den Nachtseiten der Naturwissenschaft (1808) sowie an Adam Müllers Vorlesungen Von der Idee der Schönheit (1807/08, vgl. S. 595). Die Hinweise auf den Kontext dieser Entwicklungsphase der Romantik, die in der Einleitung Graves und an vielen Stellen des Kommentars gegeben werden, sollten Anlass sein, ausgehend von einer Rekonstruktion der Sprachregelungen des ‚romantischen Diskurses‘ die eher implizit als explizit formulierten Konzepte von Friedrichs ‚Romantik‘ – des Schriftstellers und des Malers – freizulegen. Es wird deswegen hilfreich sein, wenn in einem geplanten 2. Band die „Schriften aus dem Dresdner Umfeld“ publiziert werden sollen, um aus der zeitgenössischen Diskussion die Verbreitung bestimmter Sprachregelungen erschließen zu können.
Dazu nur – ausgehend von der schon erwähnten Textverbesserung von „sehen“ zu „suchn“ – ein paar, im Rahmen der Textsorte ‚Rezension‘ knapp gehaltene, Hinweise aus literaturwissenschaftlicher Perspektive: Mir scheint, dass erst mit dieser neuen Entzifferung Friedrichs Deutung des Gemäldes zu einer genuin romantischen Äußerung wird, auf deren Basis verständlich gemacht werden kann, wie alle in Friedrichs schriftlichem und künstlerischem Werk relevanten Themen – Natur und Naturnachahmung, christlicher Glaube, Individualität, Nationalismus –, im Lichte des ‚romantischen Diskurses‘ eine neue Bedeutung bekommen. Eine grundlegende Einsicht ist die Bestimmung des Verhältnisses von Immanenz und Transzendenz bzw. der Wahrnehmung dieses Verhältnisses, die in der Frühromantik im 1. Fragment der Sammlung Blüthenstaub pointiert formuliert wird: „Wir suchen überall das Unbedingte, und finden immer nur Dinge.“ Diese Einsicht, die sich in Texten der Romantiker in vielen Varianten wiederfinden lässt, besagt, dass der Bereich der Transzendenz – die Autoren verwenden dafür unterschiedliche Bezeichnungen: das „Unbedingte“, das „Absolute“, „Ideen“, „Gott“ – nicht unmittelbar erkannt, nicht „gefunden“, d.h. nicht mit den Sinnen erfahren und vom Verstand nicht begrifflich gefasst werden kann. Was bleibt, ist allein der Weg einer Suche, die ihren Ausgang von der Anschauung der „Dinge“ nimmt. Diese Ausrichtung am „Absoluten“ bzw. an den „Ideen“ macht auch Friedrichs religiöse Deutung der Gegnerschaft zu Frankreich verständlich (vgl. Kommentar, S. 571). Wie in anderen Texten der Zeit, z.B. in den Berliner Vorlesungen August Wilhelm Schlegels, werden Kultur und Literatur Frankreichs als exemplarische Verkörperungen einer ‚ideenlosen‘ Moderne charakterisiert, weswegen aus dieser Perspektive der Krieg zu einem Glaubenskrieg wird, in dem Deutschland die Aufgabe zukommt, die Ausrichtung am „Absoluten“ für die Menschheit zu bewahren.
Es gehört zu den in romantischen Texten oft wiederholten Grundsätzen, dass jeder Mensch in seinem Inneren ein Gefühl verspürt bzw. verspüren soll, das ihn bei der Wahrnehmung seines Selbst und der Außenwelt zur Suche nach dem „Unbedingten“ antreibt. Die „Natur“, als Inbegriff aller „Dinge“ der phänomenalen Welt, kann für den, der danach „sucht“, zum „Mittler“ eines Zugangs zur Transzendenz werden, allerdings nur dann, wenn man ihr mit der Haltung der „Suche“ nach der „Idee“ seines wahren Selbst begegnet. Friedrich selbst verwendet dafür den Begriff „Gemüth“ (vgl. Äußerungen Nr. 26, S. 236) oder „ahndend fühlende Seele“ (Äußerungen Nr. 29, S. 237, Nr. 41, S. 240 und Kommentar S. 635), um in den „Dingen“ der Natur jene Zeichen zu entdecken, in denen dieses Selbst sich wiedererkennt und in ihnen den Prozess einer unendlichen Bewegung zum „Unbedingten“ wahrnimmt. Mir scheint, dass damit ein wesentlicher Aspekt der Naturdarstellung in Friedrichs Bildern umschrieben werden kann: die Abbildung von Naturphänomenen als „Erguß einer reinen tief und innig ergriffenen bewegten Seele“ (Äußerungen Nr. 147, S. 294), in der in einem Moment deren Bewegung hin zum Ziel in unendlicher Ferne sichtbar gemacht wird.
Friedrich formuliert daraus abgeleitete Forderungen an die Künstler, so z.B. in den Geboten der Kunst: „Willst du dich der Kunst witmen, fühlst du inneren Beruf ihr dein Leben zu weihen, o! so achte genau auf die Stimme deines Innern; denn sie ist Kunst in uns. […] Bewahre einen reinen kindlichen Sinn in dir, und folge unbedingt der Stimme deines Innern; denn sie ist das Göttliche in uns, und sie führt uns nicht irre!“ (S. 222) Dieser Gedanke wird in Texten der Romantik in so vielen Varianten formuliert, dass die Suche nach einer bestimmten Belegstelle vergeblich wäre. In diesem Zusammenhang ließe sich auch Friedrichs Auseinandersetzung mit ‚realistischen‘ Tendenzen der zeitgenössischen Landschaftsmalerei seit Beginn der 1830er Jahre verständlich machen. Wenn er sich in den Äußerungen (vgl. Nr. 122, S. 282) gegen die Kritik zur Wehr setzt, er habe „die Landschaftsmalerei von einer realistischen Naturauffassung entfernt und ihre gattungsgemäßen, naturimmanenten Grenzen unberechtigt zur transzendenten Dimension überschritten“ (Kommentar, S. 683), so setzt er das „innige geistige Durchdrungen sein des Künstlers von der Natur“ (Nr. 22, S. 282) dagegen, also jene Haltung des „Gemüths“, von der aus ein Zugang zum „Gemüth“ der Natur ermöglicht werden soll. Im Kommentar wird dazu im Anschluss an die Forschung auf Novalis‘ „Versuche, das Mystische und Unendliche im Endlichen zu fassen“ (S. 683 f.) verwiesen. Zur Verdeutlichung könnte man auch Friedrich Schlegels Erwartung eines neuen „Realismus aus dem Idealismus“ heranziehen, die er im Gespräch über die Poesie (1800) äußert, oder die Neufassung des Mimesis-Postulats auf der Grundlage der romantischen Naturphilosophie in Schellings Akademie-Vortrag Über das Verhältniß der bildenden Kunst zur Natur (1807). Das Gemeinsame ist die Forderung, sich bei der Darstellung an die Welt der Erscheinungen zu halten und in ihren Prozessen die Zeichen ihrer Richtung auf das Ziel der Vereinigung mit dem „Absoluten“ freizulegen.
Da im Rahmen dieser Bestimmung des Verhältnisses von „Idee“ und Erscheinung auch jedes Kunstwerk Teil der phänomenalen Welt, also wesentlich begrenzt, ist und der „Idee“ von Kunst nur annähernd gerecht werden kann, gibt es innerhalb der romantischen Ästhetik das Postulat, dass ein Kunstwerk immer auch selbstreflexive Hinweise auf die eigene Unvollkommenheit enthalten muss. Gemäß dieser „Denkfigur von der Unabgeschlossenheit und Offenheit der Kunst“ (Kommentar, S. 651), besteht die Forderung, dass „Bilder eine Struktur haben“ sollen, „die auf ihre Gemachtheit verweisen und sich von einem reinen Illusionismus unterscheiden“ (Kommentar, S. 662). Dieses Postulat wird von Friedrich an mehreren Stellen klar formuliert, z.B. in den Äußerungen: „Ein Bild muß sich als Bild als Menschenwerk gleich darstellen; nicht aber als Natur täuschen wollen.“ (Nr. 113, S. 276) Für die kunstgeschichtliche Analyse der Gemälde erwächst daraus eine schwierige Aufgabe: einen Nachweis der malerischen Gestaltung dieser Selbstreflexivität zu führen. Johannes Grave hat sich in seinen Arbeiten dieser Aufgabe schon mehrfach gewidmet.
Ein zentrales Thema in Friedrichs Schriften ist das Konzept der Individualität. Die Formulierungen zeigen, dass er sich dabei ganz im Rahmen des romantischen Individualitätskonzepts bewegt, wonach das Ganze der Welt und deren Bewegung hin zum „Absoluten“ nur in individuellen Konkretionen wirklich und nur aus der Sicht von individueller Erfahrung erahnt werden kann. Das gilt auch für Werke der Kunst, die Friedrich als höchsten Ausdruck von Individualität einschätzt. In einem Brief an Johannes Schulze heißt es dazu, „daß die Kunst eigentlich der Mittelpunkt der Welt, der Mittelpunkt des höchsten geistigen Strebens ist, und die Künstler im Kreise um diesen Punkt stehen […]. Denn die Verschiedenheit des Standpunktes, ist die Verschiedenheit der Gemüther, und sie können auf entgegen gesetzten Wege beide ein Ziel erreichen.“ (Nr. 15, S. 44 f.). Die beigefügte Zeichnung eines Kreisumfangs, auf dessen Linie einzelne Künstler platziert sind, deren Blickrichtung auf den Mittelpunkt durch Linienstriche markiert werden, ähnelt der Dialogsituation in Friedrich Schlegels Gespräch über die Poesie (1800), bei der die einzelnen Gesprächsteilnehmer ihre je eigenen Ansichten über Poesie vortragen und diese mit dem Ziel zur Diskussion stellen, sich dem „Höchsten“ anzunähern, in dem das je Eigene zu einer „Idee“ von Poesie zusammenfließen soll. An anderer Stelle der Äußerungen heißt es in einer Selbstcharakteristik: „Die Natur gab nicht einem alles, aber jeden etwas. In jeden einznen Gegenstand aber liegt eine Unendlichkeit der Auffassung und Vielseitigkeit der Darstellung“ (Nr. 129, S. 286). Die Gebote der Kunst fassen dieses Konzept bündig zusammen, und der Kommentar macht auf dessen zentrale Position im zeitgenössischen Diskurs von Kunst und Kunstkritik aufmerksam (vgl. S. 593–595).
Dem romantischen Konzept entspricht auch Friedrichs Verhältnis zum Christentum und zur Darstellung von Sujets der christlichen Tradition. Wenn auf dem Gemälde, das Friedrich in seinem Brief an Luise Sailer ausdeutet, auf dem Felsen ein Kreuz aufgerichtet ist, so kann man das als Hinweis auf das Christentum lesen, dies allerdings in romantischer Interpretation. Religion kann gemäß Schleiermachers Über die Religion nur in individuellen Gestalten in der Geschichte erscheinen, und das Christentum wird in Texten der Frühromantik, z.B. in Fragmenten von Novalis, am entschiedensten bei Friedrich Schleiermacher, als die höchste Stufe dieser Gestalten in der Geschichte der Religionen bewertet, weil es das Problem der Vermittlung von Immanenz und Transzendenz gelöst hat und weil es mit dem Bewusstsein der eigenen Unvollkommenheit das Prinzip einer unendlichen Fortentwicklung einschließt. In der Phase der Romantik nach 1800 kommt es zu entschiedenen Verteidigungen jener Elemente des christlichen Glaubens, die in der rationalistischen Theologie der Aufklärung ad acta gelegt worden waren, verbunden mit deren Neudeutung aus romantischer Perspektive. Die Abrechnung mit der Aufklärung in August Wilhelm Schlegels Berliner Vorlesungen enthält dafür eindrückliche Beispiele, etwa zur Theologie des Kreuzesopfers oder zur Abendmahlslehre. In einer Selbstdeutung des Mönch am Meer lässt sich der Einfluss dieser Kritik an der Aufklärung gut erkennen, da Friedrich dem dort dargestellten Mann – mit deutlicher Anspielung auf die Licht-Metaphorik der Aufklärung – eine Haltung des theologischen Rationalismus unterstellt: „Und sännest du auch vom Morgen bis zum Abend, vom Abend bis zur sinkenden Mitternacht; dennoch würdest du nicht ersinnen, nicht ergründen, das unerforschliche Jenseits! Mit übermüthigen Dünkel, wennest du der Nachwelt ein Licht zu werden, zu enträzlen der Zukunft Dunkelheit! Was heilige Ahnung nur ist, nur im Glauben gesehen und erkannt; endlich klahr zu wissen und zu Verstehn!“ (Nr. 16, S. 50) Der Briefempfänger Johannes Schulze war, laut Kommentar (vgl. S. 354), als Schüler Schleiermachers ein Gegner des theologischen Rationalismus, was auch für Friedrich August Koethe gilt. Ob Friedrich mit dieser Interpretation – der Kommentar rechnet sie „zu den zentralen Selbstkommentaren Friedrichs“ (S. 373) – die mehrdeutige Aussage des Gemäldes zu sehr auf eine Bedeutung reduziert, ist eine andere Frage.
Das in den Bildern Friedrichs oft dargestellte Kreuz repräsentiert ein zentrales Element des christlichen Glaubens, mit dem die Theologie der Aufklärung wenig anfangen konnte, weil es mit der anstößigen Vorstellung der Erlösung durch ein Menschenopfer verbunden ist. Insofern kann es verständlich sein, dass das Kreuz nur für den, der „sucht“, ein „Trost“ sein kann. Die Zeichen und Symbole der christlichen Religion werden als Verweise auf die Transzendenz also erst dann wirksam, wenn sie nicht mit Vernunftbegriffen gefasst werden, sondern zur „Suche“ anregen, unter der Voraussetzung freilich, dass ein Betrachter sich grundsätzlich auf eine Orientierung am „Absoluten“ eingelassen hat. Für einzig an der Erscheinungswelt Orientierte dagegen ist das Kreuz nichts als ein Gegenstand auf einem Felsen. Über Friedrichs Verhältnis zum christlichen Glauben gibt es in der Forschung unterschiedliche Auffassungen, und davon ist auch die Frage berührt, inwieweit man Friedrichs Kunst als ‚romantisch‘ deuten kann. Die dichte Verwendung von Zitaten dokumentiert, dass er mit der Bibel gut vertraut war, und man kann davon ausgehen, dass er gemäß seiner Herkunft von den Traditionen des Protestantismus lutherischer Ausrichtung geprägt war. In den Kontexten, in denen er sich bewegt hat, wird er aber von den Herausforderungen, denen dieser Glaube um 1800 ausgesetzt war, nicht unberührt geblieben sein, ebenso wird er von den romantischen Versuchen, mit einer neuen Begründung des Christentums auf diese Herausforderungen zu antworten, Kenntnis gehabt haben.
Indem Friedrich dem Kreuz auf dem Felsen nur dann die Kraft zu trösten zuerkennt, wenn man sich auf die „Suche“ macht, zeigt er sich beeinflusst von der romantischen Deutung des Christentums in der modernen Welt, in der tradierte Glaubensgewissheiten verloren gegangen sind. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass Friedrich nie die in der Bibel erzählte Kreuzigung Jesu selbst darstellt, es überhaupt vermeidet, in der Bibel erzählte Geschichten direkt abzubilden, sondern immer nur Kreuzesdarstellungen in der Natur ins Bild setzt. Der Trost spendende Glaube wird durch zwei Kunstwerke erweckt, das Gemälde und das in ihm dargestellte Kreuz. Der Romantiker Friedrich bezieht sich auf eine geschichtliche Situation, in der bei einem Teil des Publikums der Glaube an die in der Bibel erzählten Geschichten abhandengekommen ist. Von dieser Situation gehen ja auch Schleiermachers Reden aus. Die Kunst übernimmt die Aufgabe, dem Publikum der Moderne den alten Glauben neu zu vermitteln. Es kennzeichnet deswegen die Bilder Friedrichs ebenso wie viele Texte der romantischen Dichtung, wie z.B. Gedichte von Eichendorff, dass sie mehrfach adressiert sind – lesbar für traditionell gläubige Anhänger der christlichen Religion und gleichermaßen für die „Gebildeten unter ihren Verächtern“, an die sich Schleiermacher wendet.
Die Wahrnehmung dieser Situation des Christentums scheint mir auch der Grund für die Distanz Friedrichs zu jener Richtung der romantischen Malerei zu sein, die man gewöhnlich als „Nazarener“ bezeichnet. In den kritischen Äußerungen Friedrichs zu Gemälden aus dieser Richtung verbindet sich das Postulat der Individualität, das die „Nazarener“ wegen der Nachahmung von Werken der italienischen Renaissance verfehlen, mit dem Hinweis auf die gegenüber dieser Epoche veränderte Lage der Religion. Dazwischen liegt nicht nur die Aufklärung, sondern auch die Reformation. So heißt es in einer Kritik an Gemälden dieser Richtung: „Das eine Bild schmeckt nach Rafael das andere nach Michael angelo [und ihren Vorgängern]. Wehre es wohl nicht besser sie trügen alle das Geprege des der sie gemahlt an der Stirne? […] Was unsere Urväter in kindlicher Einfalt geglaubt und gethan, das sollen auch wir bei geleuterter Erkenntniß glauben und thun.“ (Äußerungen, Nr. 3, S. 228) Die im letzten Satz umschriebene Forderung, mit der Friedrich eine Meinung der Kunstkritik kritisch wiedergibt, wird an anderer Stelle drastisch formuliert: „Wenn große Leute wie die Kinder in die Stube scheißen wollten um damit ihre Unschuld oder Schuldlosigkeit beweisen zu wollen; möchte wohl nicht gut aufgenommen und geglaubt werden.“ (Äußerungen, Nr. 110, S. 275).
Der Kommentar macht neben Hinweisen auf Äußerungen in der zeitgenössischen Kunstkritik auch auf einen meinungsbildenden Text, Friedrich Schlegels Gemälde-Beschreibungen in der Zeitschrift „Europa“ (vgl. S. 619), aufmerksam, und dies könnte Anlass zu einer genaueren Rekonstruktion der innerhalb der Romantik geführten Diskussion über die Grenzen und Möglichkeiten einer Orientierung an diesen Vorbildern sein. Heranzuziehen wären dabei neben Friedrich Schlegels Gemälde-Beschreibungen auch August Wilhelm und Caroline Schlegels Die Gemählde und Schellings Akademie-Vortrag. An diesen Texten ließe sich zeigen, dass die Legitimation von Sujets der christlichen Religion in der Malerei der Gegenwart nicht ganz einfach war und bei der Frage nach der Möglichkeit von Fortschritten in der Entwicklung der Kunst – Kann man Raffael nachahmen und zugleich mit einem eigenen Werk übertreffen? – in verdeckte Aporien führte. Bei einer Rekonstruktion der Probleme dieses Teildiskurses der romantischen Ästhetik könnte man Friedrichs Kritik an den „Nazarenern“, vielleicht auch seine Entscheidung für die Landschaftsmalerei als eines zeitgemäßeren Ausdrucks religiösen Gefühls, als plausible Antwort verständlich machen.
Fazit: Die in jeder Hinsicht vorbildliche Edition markiert eine neue Etappe der Friedrich-Forschung, nicht nur, weil sie den gegenwärtigen Stand der Erkenntnis repräsentiert, sondern weil sie in vielen Punkten auf wichtige Fragen für künftige Arbeiten hindeutet, bei denen mehrere Fächer, neben der Kunstwissenschaft auch Literaturwissenschaft, Philosophie und Theologie, beteiligt sein sollten. Mein Wunsch als Literaturwissenschaftler an die Kunstwissenschaft ist, dass der dort schon eingeschlagene Weg konsequent fortgeführt wird, durch die Analyse der Bilder die Frage zu beantworten, ob, und wenn ja, mit welchen Methoden es Caspar David Friedrich gelungen ist, seine romantische Botschaft „mit Farben und Formen“ zu vermitteln.
Rezension verfasst von Ludwig Stockinger
Die Rezension ist unter dem nachfolgenden Link dauerhaft abrufbar:
10.22032/dbt.64577
Zum Verhältnis von literaturwissenschaftlicher und kunsthistorischer Romantikforschung finden Sie ein Gespräch zwischen Johannes Grave und Dirk von Petersdorff unter folgendem Link:
www.gestern-romantik-heute.uni-jena.de/kultur/artikel/caspar-david-friedrich-und-die-fruehromantik-zum-250-geburtstag-des-malers-teil-i