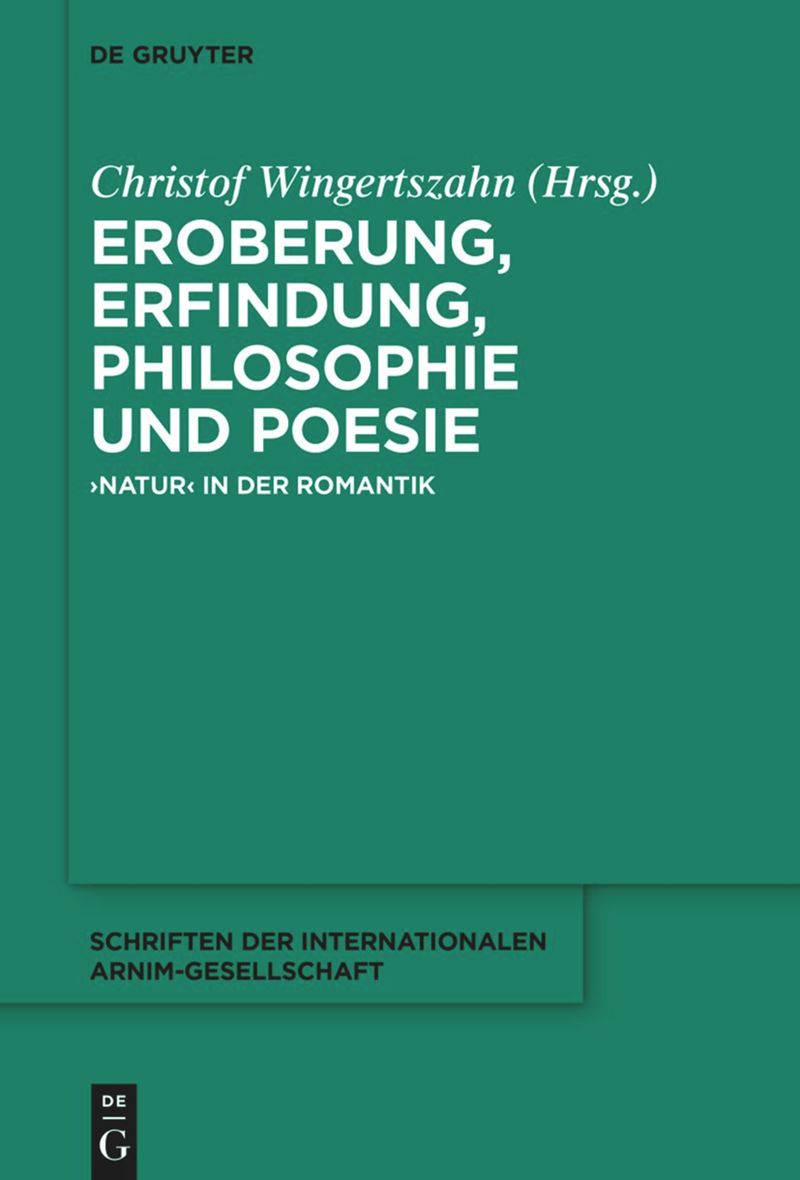Christof Wingertszahn (Hg.)
Eroberung, Erfindung, Philosophie und Poesie
‚Natur‘ in der Romantik
Der Sammelband Eroberung, Erfindung, Philosophie und Poesie. ‚Natur‘ in der Romantik ist das Ergebnis des im Jahr 2021 in Weimar veranstalteten 13. Kolloquiums der Internationalen Arnim-Gesellschaft (IAG). Er bringt 16 Beiträge zu unterschiedlichen Facetten der ‚Natur‘ in der Romantik zusammen, die in engerer oder weiterer Verbindung mit Achim von Arnim stehen. Wie der Herausgeber und Präsident der Internationalen Arnim-Gesellschaft Christof Wingertszahn im Vorwort (S. IX–XVIII) deutlich macht, gibt es „[s]elbstverständlich […] nicht ‚die Natur‘. ‚Natur‘ wurde und wird aus den unterschiedlichsten Perspektiven wahrgenommen, beobachtet, erklärt und symbolisch verrätselt.“ (S. X) Die Offenheit des Begriffs spiegelt sich bereits im Untertitel des Bandes wider, der ‚Natur‘ relativ setzt. Der Haupttitel verspricht ein breites Spektrum an Beschäftigung mit der ‚Natur‘, das durch vier Sektionen im Band eingelöst werden soll: 1. Naturwissenschaft, Naturphilosophie, Naturpoesie mit sieben Beiträgen, 2. Darstellung und Erfindung von Landschaft mit drei Beiträgen, 3. Eroberung der Natur mit vier Beiträgen sowie 4. Naturmetaphorik mit zwei Beiträgen. Der Band schließt mit einem ausführlichen Literatur- und dem Autorenverzeichnis ab. Die Lektüre des Sammelbandes – so viel sei vorweggenommen – ist erhellend, wenn auch durch die Breite der angebotenen Themen eine leichte Tendenz des Überangebotes entsteht. In Teilen bleibt bei ausgewählten Aspekten der Wunsch zurück, tiefergehend etwas darüber zu erfahren.
Die Beiträge können hier im Folgenden nur kursorisch vorgestellt werden. Ich beschränke mich auf eine Auswahl, die jedoch alle vier Sektionen berücksichtigt. Die erste und längste Sektion Naturwissenschaft, Naturphilosophie, Naturpoesie (S. 3–111) widmet sich verschiedenen Disziplinen wie der Naturästhetik, der Erfahrungsseelenkunde, der Traumdeutung, der Chemie, der Mathematik sowie der Philosophie. Die hier vorgelegte interdisziplinäre Kenntnis in Verbindung mit Arnim ist beeindruckend. Dies führt jedoch auch dazu, dass nur lose Verbindungen zwischen den Beiträgen entstehen.
Roswitha Burwick vergleicht Achim von Arnims und Alexander von Humboldts wissenschaftliche Auseinandersetzung in Bezug auf die Ästhetik (S. 3–22) und arbeitet dabei Arnims Verständnis von Naturforschung heraus: „Empirik, das heißt Vereinzelung und dann Spezialisierung in den verschiedensten Wissenschaftszweigen, ist für ihn nur die eine Seite der Naturwissenschaft. Die andere ist, sich mit dem komplexen Wechselwirken auseinanderzusetzen, das kreatives Denken verlangte.“ (S. 4) Arnim denke „Natur, Wissenschaft und Kunst“ (S. 4) zusammen, ‚Erfinden‘ sei für ihn „Aktion, Progression, positiver Fortschritt, die notwendigerweise nicht in der Gelehrtenstube stattfinden, sondern nur durch die Erfahrungen in der Natur selbst in Wissen umgesetzt werden können“ (S. 5). Diese Vorstellung unterscheide ihn von Humboldt, der seine empirischen Ergebnisse nicht selbst poetisch formuliert habe, sondern andere durch Poesie für ihn sprechen ließ, wie ein intertextueller Einschub von Friedrich Schillers Braut von Messina in seinem Werk Bedrängte Gemüther (vgl. S. 19) belegen soll. Das Ausdrücken von Affekt wird bei Humboldt, anders als bei Arnim, nicht von ihm selbst vorgenommen. Arnims Liedersammlung Des Knaben Wunderhorn (1805–1808) und Humboldts Schriften aus dieser Zeit seien somit „Zeugnisse der verschiedenen Richtungen, die beide Naturforscher einschlugen“ (S. 22).
Es folgt ein Beitrag von Sheila Dickson zu „Karl Philipp Moritz’ Erfahrungsseelenkunde“ (S. 23–35), der die „innere Natur“ (S. 24) fokussiert, bevor sich Christof Wingertszahn Achim von Arnims Verhältnis zum Traum widmet (S. 37–54). Dabei geht es um die Natur, verstanden als „Vor- und Unbewusstes der menschlichen Psyche“ (S. 37): „Das Innere des Menschen rückt als Landschaft näher.“ (S. 37) Wingertszahn blickt dabei nicht auf die „poetischen Traumdarstellungen“ (S. 38) Arnims, sondern auf deren mögliche Grundlage: „dem wissenschaftlichen Standort des Autors hinsichtlich der Traumerfahrungen, seiner persönlichen Würdigung des Träumens und schließlich der Frage, ob die Mechanismen der Traumarbeit für ihn auch ästhetisch maßgeblich werden konnten.“ (S. 38) Besonders hervorzuheben ist dabei das Projekt des Traumaufschreibens, das sowohl von Arnim, Brentano als auch von den Grimms zeitweise verfolgt wurde und sogar in ein „Traumtagebuch“ (S. 48) mündete. Dies diente der „empirischen Beobachtung des eigenen Innenlebens, wirkte im gemeinsamen Besprechen therapeutisch hinsichtlich des eigenen Stands in der Welt und fungierte nicht zuletzt auch als Reservoir poetischer, unkonventioneller Ideen“ (S. 48). Auch Traumnotate von Arnim werden in diesem Beitrag zitiert und in ihrer Seltenheit für die Romantik hervorgehoben.
Die Sektion bietet weiterhin einen Beitrag von Steffen Dietzsch zur Frage „Wie ist organische und anorganische Natur zusammen verstehbar“ (S. 55–66), von Olaf L. Müller zum „Parallelepipedon“ (S. 67–86) sowie von Hans-Georg Pott zu „Erkenntnisformen der Naturkräfte um 1800“ (S. 87–100), bevor sie mit Lothar Ehrlichs Beschäftigung mit der Natur in Arnims Hollin’s Liebensleben schließt (S. 101–111). Darin wird im Zuge der Untersuchung dieses Romans die Entscheidung Arnims deutlich, nach seiner Bildungsreise 1801/1803 „nicht mehr als Naturforscher, sondern als Dichter tätig zu sein“ (S. 110). Dies wird insbesondere mit der Annahme begründet, dass der Dichter im Gegensatz zum Forscher „in seiner Erkenntnis der Natur“ (S. 110) nicht aufs Einzelne, sondern aufs Ganze zielen sollte.
Die zweite Sektion Darstellung und Erfindung von Landschaft wird von Konrad Feilchenfeldts Beitrag zur „Natur im Fokus zwischen Landschaftsdarstellung und ‚Portrait‘“ (S. 115–133) eröffnet, der insbesondere Friedrich Schlegels Gemäldekritik ins Zentrum rückt und dabei verschiedene Formen der Naturnachahmung in der Malerei betrachtet (Philipp Otto Runge und Caspar David Friedrich im Vergleich). Es folgt ein Beitrag von Walter Pape zum „Oberrhein“ (S. 135–159) und von Roger Paulin zur Frage nach der „Destruktive[n] Natur“ am Beispiel von Vulkanbildern (S. 161–175), die sich beide durch besonders kurze Unterkapitel auszeichnen. So erfährt man leider nur auf drei Seiten, was Schiller über den Rhein dachte und schrieb, auf je einer Seite, wie Hölderlin und Eichendorff zum Oberrhein standen oder auf zwei Seiten, wie Jean Paul Vulkanausbrüche imaginierte. Dabei wäre es gerade bei diesen Naturschauspielen – wie sowohl der Rheinfall als auch Vulkanausbrüche um 1800 bezeichnet wurden – in hohem Maße interessant gewesen, wie die genannten Autoren die Bildwürdigkeit dieser Ereignisse reflektieren. In der Kürze der Beiträge war dies wohl nicht darstellbar.
Die dritte Sektion Eroberung der Natur wird seitenmäßig dominiert von Norman Kaspers Beschäftigung mit der „Dynamische[n] Naturgeschichte der Weltseele“ (S. 179–205), in der Gustav Carus’ Interesse an der Paläontologie ausgehend von einem 1816 im Rahmen der Einweihung der Dresdner Medizinisch-Chirurgischen Akademie von ihm gehaltenen Vortrag entfaltet wird. Diese Rede sei gerade keine „romantische Naturphilosophie“ (S. 185) gewesen, die Natur noch nicht „als materielle Repräsentation von Ideen betrachtet“ (S. 186) worden. Später jedoch habe Carus, ebenso wie Franz Unger, „paläontologische Naturforschung als romantische Naturphilosophie“ (S. 201) verstanden und betrieben. Die Deutung fossiler Zeugnisse und Rekonstruktionsbemühungen mit Darstellungsmöglichkeiten der Landschaft werden darin zusammengebracht.
„Fabriken, Chausseen und Eisenbahnen“ bilden das Zentrum des Beitrags von Stefan Nienhaus (S. 207–216). Der kurze, aber informative Beitrag widmet sich den frühen Auswirkungen der Industrialisierung bereits um 1800, die im Landschaftsbau nachzuverfolgen sind. Anhand der Beschäftigung von Adam Müller, Hegel und Novalis mit dem Verhältnis von Natur, Glück und Freiheit wird gezeigt, inwiefern die Industrie als zentrale Komponente in diesem Zusammenspiel betrachtet wird. Als Fazit beschreibt Nienhaus, dass „[d]ie idyllische Einsamkeit des romantischen Wanderers […] keinen Platz mehr im verkehrstechnisch erschlossenen Raum [hat], der von den reisenden Philistermassen auf der Suche nach der ‚unberührten Natur‘ besetzt und auf eine Erholungsfunktion reduziert wird.“ (S. 216)
Mit einer weiteren, neuen Facette von ‚Natur‘ befasst sich Friederike von Schwerin-Highs in ihrem Beitrag zu „Lessings Natur-Begriff laut den Schriften seines Bruders Karl Gotthelf Lessing“ (S. 233–251), der sich intensiv mit der Bearbeitung Karls von Gottholds Schriften beschäftigt und dabei herausarbeitet, was die beiden Brüder für Natur bzw. Natürlichkeit beim Schreiben hielten.
Zwei Beiträge aus unterschiedlichen Sektionen sind vergleichend zu betrachten, weil sie Bettine (manchmal heißt es auch „Bettina“, vgl. S. 255, S. 260, S. 266) von Arnims Perspektiven aufnehmen: Renate Moerings Auseinandersetzung mit „Achim von Arnims Umgang mit der Natur“ als Landwirt (S. 217–232) sowie Barbara Becker-Cantarinos Untersuchung von „Bettina (sic!) von Arnims Naturmetaphern“ (S. 255). Ersterer handelt zwar vornehmlich von Achim von Arnims landwirtschaftlicher Tätigkeit in Wiepersdorf, wohin sich die Familie seit 1814 zurückgezogen hatte, wirft jedoch wiederholt Seitenblicke zu Bettine. 1818 kam zu Wiepersdorf das Gut Bärwalde hinzu und Arnim konnte durch dessen Bewirtschaftung die Familie ernähren. Bettine von Arnim war zu diesem Zeitpunkt bereits nach Berlin zurückgegangen, Renate Moering zitiert und referiert aus dem Briefwechsel zwischen Achim und Bettine, der deutlich macht, wie sehr sich Arnim für die Versorgung durch die Bewirtschaftung der eigenen Güter einsetzte und wie wenig dies von Bettine offenbar geschätzt wurde. Herzzerreißend ist dabei die Episode über eine Eselin mit Fohlen, das Bettine in Berlin zu halten gedachte und das aufgrund der schlechten Versorgung dort bald verstarb, nachdem es zu Achim auf das Landgut geschickt worden war (S. 228). Der Beitrag zeigt, dass Achim stets „neben der Nützlichkeit des Landlebens“ (S. 232) die Gestaltung der Landschaft im Blick hatte, die ihm schon mindestens seit der Betrachtung ausgewählter Landschaftsmalerei wie derjenigen Claude Lorrains in einer Ausstellung in Kassel 1806 beschäftigte (S. 217).
Die bei Moering skizzierte Bettine scheint wenig gemein zu haben mit der jüngeren Bettine, die in Becker-Cantarinos Beitrag zur Sprache kommt. Denn diese nutzt intensiv und oft „den Reichtum von Metaphern aus der Natur, besonders aus den Bereichen der Botanik und der Tierwelt“ (S. 255). Als Beispiel dafür gilt der 1844 von ihr veröffentlichte Text Clemens Brentano’s Frühlingskranz, der dem Untertitel zufolge auf einem Briefwechsel der Geschwister von etwa 1800 bis 1804 (S. 255) basiert. Wiederholt geht es darin um ein „visuell konzipiertes Naturbild mit Stimmungen, das die Natur vermenschlicht“ (S. 257) sowie die durch gezähmte Natur abgebildete Zivilisation (beispielsweise durch Bosketts). Hervorzuheben ist dabei die Figur eines Gärtners, über den Bettine mehrfach schreibt. Dieser sei „dienstbarer Hüter der zivilisierten Natur“ (S. 258) und Teil des Spiels, das Bettine mit der von ihr beschriebenen Natur spielt. Die Reflexion über das Verhältnis von Kunst und Natur, die Metaphorik von Blumen und die Darstellung der sensuellen Wahrnehmung dienen auch der „Selbstinszenierung“ (S. 265), die Verwendung von Bildern der kultivierten, eingehegten und gepflegten Natur ermögliche „Ausbruchs- und Verweigerungsfantasien des ‚Ich‘“ (S. 266). Die beiden Beiträge lesen sich wie zwei Seiten von Bettine von Arnim: diejenige der Natur-Liebenden und aus der Natur Schöpfenden sowie diejenige, die wenig für Landwirtschaft und Gärtnerei übrig hat. Diese Zusammenschau motiviert zu einer weiterführenden Untersuchung des Verhältnisses von Bettine von Arnim zu Natur – als Ehefrau und Autorin, also in unterschiedlichen Rollen.
„Musik und Natur um 1800“ stehen bei Ursula Reichert (S. 267–287) im Zentrum. Der Beitrag zeigt anhand der musiktheoretischen Schriften von Jean-Philippe Rameau und Jean-Jacques Rousseau das differierende Naturverständnis der Harmonisten und der Melodisten. Für Achim von Arnim und Clemens Brentano wird dies insbesondere in Bezug auf den von beiden in Giebichenstein mehrfach besuchten Komponisten Johann Friedrich Reichardt virulent, der sich mit der Natürlichkeit der Musik eingehend beschäftigte. Reichardts Einfluss zeige sich vor allem bei der Liedersammlung Des Knaben Wunderhorn, deren Band von 1808 „musizierende Menschen aus älteren Zeiten“ (S. 282) auf dem Titelblatt abbildet. Allerdings, so macht der Beitrag deutlich, führe der „Versuch, eine ‚natürliche‘ Musik auf künstlichem Weg zu erschaffen, […] zu einem grundsätzlichen Problem“ (S. 283). Das Problem von Ideal und Natur werde insbesondere bei der Vertonung mehrstrophiger Lieder greifbar. „Entweder man folgte dem Text strophenweise und vertont jeweils anders oder man behält die Melodie bei, in der Hoffnung, dass die übergreifende Emotion des gesamten Textes getroffen wird.“ (S. 284) Die Natürlichkeit von Kunst und verschiedene Sichtweisen, diese zu erreichen, werden in diesem letzten Beitrag des Bandes thematisiert.
Zusammenfassend lässt sich sagen: das, was mit ‚Natur‘ gemeint sein kann, ist unbestritten nahezu grenzenlos. Dies wird im Band reflektiert, kommentiert und nahezu performativ durch das breite Angebot an Naturbegriffen umgesetzt. Darunter leiden zwar die Stringenz und thematische Intensität des Sammelbandes etwas; der Anreiz, sich mit einzelnen Themen im Anschluss weiter zu beschäftigen, ist dafür umso größer. Der Sammelband ist nahezu fehlerfrei redigiert und gesetzt, die farbige Bebilderung einiger Beiträge macht ihn äußerst anschaulich, was gerade in Bezug auf Landschaftsmalerei oder naturwissenschaftliche Skizzen hilfreich ist. Den Beitragenden und dem Herausgeber sei für den vielschichtigen Einblick in die Naturbeschäftigung der Romantik in jedem Fall gedankt.
Rezension verfasst von Anna Axtner-Borsutzky.
Die Rezension ist unter dem nachfolgenden Link dauerhaft abrufbar:
10.22032/dbt.65484