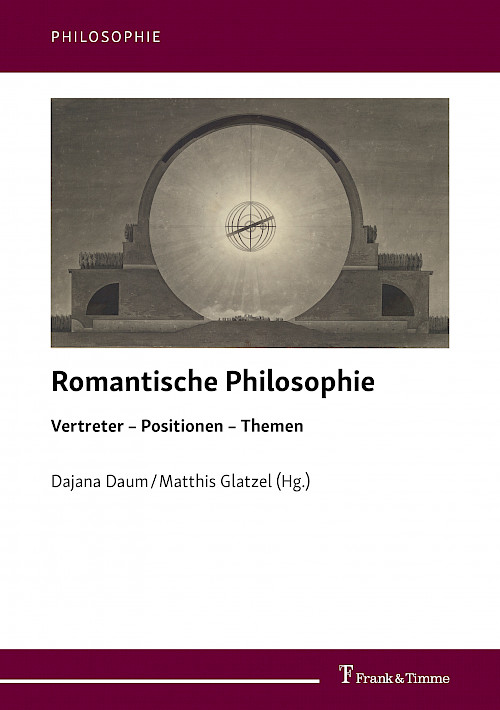Dajana Daum, Matthis Glatzel (Hgg.)
Romantische Philosophie
Vertreter - Positionen - Themen
In einer Oszillation zwischen moderner Partikularisierung und dem Streben nach einem einheitsstiftenden Systemgrund kann die Epoche der Romantik als ein über sich hinausweisendes strategisches Line-Up charakterisiert werden, das auf gesellschaftliche Umbrüche um 1800 reagiert. Während die romantische Kunst und Literatur auf den Verlust von gesellschaftlicher Einheit mit dem Gedanken der Autonomie reagiert, befasst sich die romantische Philosophie vor allem mit der Anknüpfung und Abgrenzung von der Kantischen Philosophie. Es geht dabei um den Wunsch der Überwindung der von Kant formulierten Probleme und um die stete Annäherung an einen einheitsstiftenden Systemgrund. Dieses Ansinnen aus philosophischer Perspektive zu ergründen, hat sich der vorliegende Band zur Aufgabe gemacht.
Die Beiträge des Bandes sind das Ergebnis eines Workshops des Jenaer Graduiertenkollegs „Modell Romantik“, das sowohl die Romantik in ihrer historischen Gestalt als auch in ihrer Fortwirkung bis in die Gegenwart untersucht. Der Band folgt keinem spezifischen Aufbau, sondern umreißt in einzelnen Schlaglichtern die philosophische Produktivität dieser Zeit. Dabei läuft immer auch die Frage mit, inwiefern einzelne Auseinandersetzungen und philosophische Gedanken in das romantische Programm einzuordnen und damit zu verbinden sind. Neben den Beiträgen liefert die fundierte Einführung eine Einordnung in die gegenwärtige Forschungslinie philosophischer Romantik, mit einem Verweis auf Dalia Nassars programmatische Einsicht, die Romantiker*innen befänden sich im Brennpunkt der nachkantischen Debatten, mit dem Anspruch, an dessen Philosophie gehaltvoll andocken zu können. Dabei ist es – wie in der Einführung deutlich gemacht – nicht Anliegen des Bandes, eine solche nachkantische, „romantische Philosophie“ zu präsentieren, sondern lediglich Denkfiguren und philosophische Einsichten dieses Brennpunkts zu erheben.
Als Paradebeispiel der erwähnten Debatte um die kantische Philosophie kann Andreas Kubiks Beitrag zum Begriff der ‚intellektuellen Anschauung‘ gelten. Kubik umreißt den Diskursraum für eine begriffsgeschichtliche Untersuchung, in dem er einige Hauptmarkerpunkte der damaligen Debatte um die ‚intellektuelle Anschauung‘ bearbeitet. Der Begriff, von Kants Kritiken degradiert und von Reinhold partiell rehabilitiert, mündet bei Fichte in einen doppelten Begriff. Fichte selbst, so arbeitet es Kubik heraus, meinte wie Reinhold etwas anderes als Kant mit seinem doppelten Begriff der ‚intellektuellen Anschauung‘, lehnte diesen aber bewusst an dessen kantische Begriffsgeschichte an, um diesen für sich im Sinne seiner Philosophie fruchtbar zu machen. Mit Schelling erfährt der Begriff dann noch eine absolutheitstheoretische Umdeutung. Kubik stellt zum Schluss noch die Frage in den Raum, ob es eine Quelle für die frühromantische Verwendung des Begriffs vor Fichtes Zweiter Einleitung (1797) gibt und bringt zur Sprache, wie unterschiedlich leidenschaftlich die Rezeption des Begriffs unter den Frühromantikern ausfällt.
Die Kippfigur im Fichteschen Denken und damit seine Anschlussfähigkeit an das romantische Programm nimmt sich Gesa Wellmann in ihrem Beitrag vor. Anhand der Untersuchung von Fichtes Schrift der Gründzüge des gegenwärtigen Zeitalters (1804/1805) arbeitet sie heraus, dass Fichte romantisch philosophiert und dies dann selbst wieder untergräbt. Wellmann argumentiert, dass Fichte das geschichtsphilosophische Problem der Kontingenz versucht mit transzendental-philosophischen Prozessen des Selbstbewusstseins zu lösen, indem er das Ich als Quelle der Erfahrung ausweist, um der Vermittlung zwischen der historisch-empirischen und der spekulativ-philosophischen Sphäre des Systems beizukommen. Dieser transzendental-philosophische Prozess ist dabei zwar durch eine romantische „Einheitssehnsucht“ (S. 72) motiviert und geschieht im schöpferischen Individuum, er ist dabei aber immer fest an das System der Wissenschaftslehre zurückgebunden und das Individuum an einen „unromantischen Platz“ (S. 72) gesetzt. Fichte deutet damit als Kontingenzbewältigung einen schöpferischen Prozess ähnlich einer „unendlichen Annäherung“ (S. 73) an, der sich zum einen immer wieder selbst einholen muss, aber zum anderen stets innerhalb des Systems verortet wird.
Als prominenter Vermittler der Frühromantik zwischen dem Allgemeinen und Individuellen kann Friedrich Schlegel gelten, dem neben zahlreichen Verweisen auch zwei eigene Beiträge gewidmet sind. Zunächst geht es bei Johann Gartlinger um die antiken Einflüsse von Schlegels Skepsisverständnis und dessen funktionale Rolle bei der romantischen Vermittlung. Mit einer Darlegung antiker Skepsis bei Cicero und Sextus Empiricus sowie einer Differenzierung der akademischen und pyrrhonischen Skepsis kommt Gartlinger zu dem Schluss, dass Schlegel Elemente dieser antiken Skepsis aufgenommen und weiterverarbeitet hat. Besonders die pyrrhonische Einsicht, der steten Wahrheitssuche kommt bei Schlegel zum Tragen, in dem er in seiner Skepsis nach Gartlinger eine Weiterentwicklung der Kantischen Philosophie von der reinen zu einer „sozialen Vernunft“ (S. 96), die Wahrheit als relativ zu sozialen Formen wie der Gesellschaft zu betrachten, vornimmt. Die Eigenständigkeit der Skepsis bei Schlegel gegenüber der Antike zeigt sich dann für Gartlinger in Schlegels Betonung der „selbstdestruktive[n] Tendenz“ (S. 101) der Skepsis, weshalb es in der modernen Skepsis nur um eine Dynamik aus „Selbstschöpfung und Selbstvernichtung“ (S. 101) gehen kann. Um diese Dynamik ringt Schlegel zuletzt auch formal, indem er das Fragment als geeignete Ausdrucksform im Sinne eines „geeigneten Vehikels“ (S. 104) für das romantisch-skeptische Wechselspiel ausweist.
Sodann liefert Andreas Arndt einen Überblick über Schlegels Versuch einer nachkantischen positiven Dialektik samt prominenter Funktion der Einbildungskraft für Schlegels „Totalisieren von unten herauf“ (S. 110). Dies resultiert für Schlegel aus der Methode des „Wechselverweises“ (S. 115), die in ihrer Progressivität die Relativität der immer nur historisch eingefassten Totalität ernst nimmt und deshalb ihren finalen Ausdruck nur in einer Ästhetik finden kann, die Arndt bei Schlegel mit der Einbildungskraft und seinem Programm der ‚Neuen Mythologie‘ ausweist. Ihre Aufgabe ist es, der Relativität eine „poetisch konstituierte Totalität“ (S. 117) entgegenzusetzen. Die Schlegelsche, dialektische Einbildungskraft liefert dabei die Verknüpfung sowohl der begrifflichen Teile der Vernunft als auch der Vorbegrifflichen, in dem sie auch den Widerspruch auf das Unbedingte zurückführt.
Der Versuch eines Einheitsstrebens der Frühromantiker zeigt sich auch in den folgenden zwei Beiträgen zu Novalis. Zum ersten liefert Rylie Johnson einen Beitrag über die konstitutive Rolle der Negation anhand der Fichte-Studien zur Lösung des Fichteschen Problems einer Begründung von Negativität im Absoluten sowie der Vermittlung von Idealismus und Realismus. Sie argumentiert, dass Novalis anhand seines magischen Idealismus, also einem „Renouncing the Absolute“ (S. 131) und der Imagination, diese Einheit verwirklichen will. In der Entsagung des Absoluten kann erst die Positivität des absoluten Ich und damit eine freie Ich-Identität erreicht werden.
Zum zweiten bearbeitet Sarah Goeth Novalis‘ Versuch einer Universalwissenschaft samt universaler enzyklopädisch-kritischer Philosophie, die in Auseinandersetzung mit Kant und Fichte die Bedingungen von Wissen in allen Disziplinen anhand einer „wissenschaftlichen Poesie“ (S. 150) systematisieren will. Goeth argumentiert, dass Novalis besonders in der Figur der Analogie die Vermittlung zwischen dem subjektiven Erkennen und der Objektivität der Gegenstände vornimmt. Sie liefert demnach eine Zusammenschau der geometrischen Analogien in den Fichte-Studien mit dem Fazit, dass erst die Wechselbeziehung von Denken und empirischem Empfinden in der doppelten Reflexionsbewegung der sich „kreuzenden Analogie“ (S. 167) für Novalis das absolute Ich kreiert. In Anwendung dieser progressiven Relation auf die Bedingungen von Wissen aller Disziplinen ist Novalis’ analogisches Wissenschaftssystem für Goeth romantisch und modern.
Als inhaltlich und formale Anhängerin der Frühromantik, die auch ohne System philosophisch sehr produktiv war, charakterisiert Johanna Raisbeck Rahel Levin Varnhagen. Ihre dialogische Aphoristik ist für Raisbeck unbedingt romantisch und lässt sich in das Umfeld frühromantischer Debatten rund um das Athenaeum einordnen. Raisbeck skizziert, dass Varnhagens formale Unbestimmtheit auf der Verwendung hybrider Textsorten beruht, die, ähnlich wie bei den frühromantischen Gattungsexperimenten, anhand eines Dialogs zwischen Inhalt und Form zu Interpretationsversuchen anregen soll. Die Aphorismen haben dabei keine universelle Ambition, sondern die Funktion der Ästhetisierung der Philosophie gegen einen „selbstgefällige[n] Systemdrang“ (S. 190).
Für Katia Hay liefert Schelling in seiner Philosophie der Identität die Basis für das romantische Projekt, in dem dieser, in Anlehnung an Schlegels romantische Poetik, in seinem Würzburger System 1804 die Kunst als die Repräsentanz der Identität ausweist, die als „endless source of productivity and creativity“ (S. 215) in einem realen Objekt auf sich als absolute Identität selbst reflektiert. In diesem Potential der Kunst, die Identität in objektiver Weise greifbar zu machen, geht es Schelling auch um die Vereinigung von Kunst und Philosophie und damit um die Transformation des Realen anhand einer neuen Mythologie.
Zuletzt würdigt Florian Priesemuth Schleiermacher anhand seiner Grundlinien der Kritik der bisherigen Sittenlehre als romantischen Philosophen, da er in seiner Ethik die Vermittlung von Individuellem und Allgemeinem im menschlichen Handeln verwirklicht sehen will. Denn für ein ethisches System bedarf es einer leitenden Idee, die sich in jedem Handeln wiederfinden muss, das als ‚gut‘ klassifiziert wird. Aus der gemeinsamen guten „Beschaffenheit“ (S. 229) menschlichen Handelns lässt sich dann das System ableiten. Darin sowohl im postulierten Potential der Ethik als Wissenschaft als auch in seiner Betonung der Individualität sieht Priesemuth Schleiermacher als romantischen Ethiker an, der aber stets mit „Ausgleichsfiguren“ (S. 232) zur Vermittlung beider Sphären arbeitet.
Bei dem Band Romantische Philosophie handelt es sich um eine facetten- und ertragreiche Publikation. Dabei sei lediglich als Manko angesprochen, dass die Beiträge unverbunden nebeneinanderstehen und sich kein roter Argumentationsfaden durch den Band zieht. Allerdings bietet sich der Band seinem Selbstanspruch nach als Debattenbeitrag rund um die Problemstellung des „Modell Romantik“ aus philosophischer Sicht an, so dass er in jedem Fall eine anregende Lektüre für das Einfinden und die Inspiration in die romantisch-philosophische Fragestellung rund um die Kippfigur eines Einheitsstrebens samt eigener Relativierung in Aussicht stellt.
Rezension verfasst von Margitta Dümmler.
Die Rezension ist unter dem nachfolgenden Link dauerhaft abrufbar:
https://doi.org/10.22032/dbt.65516